Professor Dr. Johann Christoph Bürgel ist immer wieder unser Gast in München; nicht zuletzt auch in unseren Publikationen (s. EOTHEN V und VI). Doch die Veranstaltung am 2. Mai 2013 war ein besonderes Ereignis: Die Gesellschaft konnte ihm das Buch Nachtigallen an Gottes Thron überreichen, worin Mehr Ali Newid und Peter-Arnold Mumm auf Wunsch des Autors und mit Unterstützung der Gesellschaft siebzehn so genannte Kleinschriften, also eine Auswahl von Aufsätzen, die in 30 Jahren, von 1978 bis 2008 in vielen verschiedenen internationalen Zeitschriften erschienen sind, herausgegeben haben. Nun stehen sie der Wissenschaft und dem interessierten Laien sozusagen „gebündelt“ und bequem zur Verfügung.
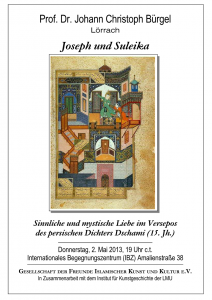
Aus diesem Anlass hatten wir Prof. Bürgel gebeten, uns ein paar autobiographische Skizzen mit Bezug zu den „Kleinschriften“ zu überlassen. Daraus ist nun nicht weniger als eine kleine Autobiographie seines Forscherlebens mit vielen bekannten Namen und interessanten Begebenheiten geworden. Bereits der jetzt vorliegende Textumfang verbietet es, ihn vollständig in die Website aufzunehmen; zudem hat der Autor angeboten, den Text noch zu erweitern und ihn einer Endredaktion zu unterziehen. Wir haben hier – gleichsam als Kostprobe – die ersten Kapitel aufgenommen. Den völlig überarbeiteten Gesamttext finden Sie in EOTHEN VI.
Über mich
„1. WIE ICH ZUR ORIENTALISTIK KAM.
Von Hause aus (mein Vater war Pfarrer) hatte ich keinerlei Beziehung zu meinem späteren Berufsfeld, weder zum Orient noch zum Islam. Es ging mir also nicht wie manchen Kollegen, die als Kinder von Diplomaten oder anderweitig im Orient tätigen Eltern aufwuchsen. Ich hatte zwar eine Zeitlang Karl May gelesen, namentlich die ersten 6 in Kleinasien spielenden Bände (Von Bagdad nach Stambul, Durchs wilde Kurdistan etc.), aber nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass man daraus ein Beruf machen könnte.
Ich wollte Musik studieren, fiel durch die Aufnahmeprüfung. Hinterher rief mich meine am Hoch’schen Konservatorium tätige Klavierlehrerin an, die ein halbes Jahr vor dieser Prüfung erkrankt war: „Ein Wort von mir und Sie wären drin gewesen!“ Ich: „Genau das wollte ich nicht, wollte das Schicksal entscheiden lassen“. Die Musik blieb eine gute Freundin, die mir immer wieder Türen öffnete, z.B. in Ankara, aber nie Ärger machte.
2. STUDIUM
Ich schrieb mich also an der Universität Frankfurt a. M. ein, wusste aber nicht, was ich studieren sollte, studierte mehrere Semester lang verschiedene Fächer in der Philosophischen Fakultät, dann, einer plötzlichen Eingebung folgend, ein Jahr lang Medizin, daneben Arabisch.
Sellheim (damals Ritters Assistent, der den arabischen Anfängerunterricht erteilte): „Kommen Sie doch zu uns, Sie sind doch begabt!“ So ließ ich, zum Kummer meiner Eltern, auch die Medizin hinter mir und schrieb mich für das Fach Islamwissenschaft (damals hieß es noch “Orientalistik“)ein.
HELLMUT RITTER
Hellmut Ritter, eine international bekannte Koryphäe des Faches, war damals für einige Jahre in Frankfurt, verließ die Stadt aber bald wieder und ging zurück in seine zweite Heimat, die Türkei.
Ritter las mit uns Anfängern schwierige bis schwierigste Texte. Angefangen bei einer berühmten arabischen Grammatik, genannt Mufassal, deren lakonischer Stil nur mithilfe des Kommentars von Ibn Ya‘îsh halbwegs verständlich wird. Hinzu kamen dann früharabische Dichter, z.B. Ibn al-Mu’tazz, dessen anmutige Wein- und Jagdgedichte wie leckere aber zähe Knochen unverdaulich vor uns lagen. Und schließlich, kaum weniger schwierig, Nizami, den er liebte und uns lieb zu machen suchte. In der Tat rührt meine Begeisterung für diesen Dichter, dem ich einen beträchtlichen Teil meiner Lebenszeit gewidmet habe, von diesen Anfängen her. Ich machte einen ersten Übersetzungsversuch, übertrug die zauberhafte Erzählung von König Bahram und seinem Sklavenmädchen Fitne, zeigte sie Ritter, der sich in seinem Echo bedeckt hielt. Ich hörte ihn aber bald darauf zu Willy Hartner, dem polyglotten Professor für Geschichte der Naturwissenschaften, der auch das Arabische und Persische, und obendrein das Chinesische erlernt hatte, sagen: „Ein Schüler von mir hat Nizami übersetzt – in Knittelverse.“ Ritter hatte es also nicht über sich gebracht, mir dieses vernichtende Urteil selber zu sagen, es aber vielleicht so eingerichtet, dass ich es wie zufällig und indirekt von ihm vernahm.
Ritter mochte mich, das war ganz klar, und unser beider Liebe zur Musik mag das Ihre dazu beigetragen haben. Er hatte sich eine Villa im Taunus gekauft, von dem Erlös seiner im Orient, vor allem in Istanbul, erworbenen Bibliothek, die er der Universität vermacht hatte, mit der Maßgabe, sie bis zum Ende seines Lebens behalten zu dürfen. In diese Villa lud er mich ein und bat mich völlig überraschend, ihm die Englische Suite in a-moll von Bach zu spielen, eine willkommene Bitte, die ich ihm aber erst beim nächsten Besuch erfüllen konnte. Ritter war Cellist und in Istanbul, wohin er in jungen Jahren entschwunden war, Mitglied des damals bekannten Amari-Quartetts. „In meiner besten Zeit habe ich täglich drei Stunden geübt“, sagte er mir. „Welche Pianisten schätzen Sie?“ fragte er mich. Ich nannte Elly Ney, die ich kurz vorher voll Bewunderung in einem Beethoven-Konzert gehört hatte. Er winkte ab: „Die!? – Wenn Sie wissen wollen, wie Beethoven wirklich klingt, müssen Sie Arthur Schnabel hören!“ Dann legte er eine Platte mit von diesem Pianisten gespielten Beethoven-Sonaten auf. Ich kannte das Stück, hörte aber fast nur ein jämmerliches Kratzen, mochte ihm das aber nicht sagen.
HESHMAT MOAYYAD und die Baha’i-Religion
Aus den Frankfurter Jahren ist noch ein lieber Freund zu nennen: Der Perser Heshmat Moayyad, der damals bei Ritter promovierte und den persischen Anfängerunterricht erteilte. Ihm und seiner Geduld verdanke ich es, dass ich nach relativ kurzer Zeit anfing Persisch zu reden. Moayyad vermittelte mir aber noch eine weitere Welt. Er war gläubiger Baha’i, machte mich mit den wunderbaren Frankfurter Teppichhändlern bekannt, deren klare leuchtende Patriarchengesichter ich heute noch vor mir sehe. Sie waren persische Baha’is, Inhaber großer, reich bestückter Läden in Bahnhofsnähe. Moayyad zeigte mir den Baha‘i-Tempel in Hohenheim im Taunus, später bei meinem ersten Besuch in Chicago auch den noch größeren Tempel in Wilmette bei Chicago, ein eigentümliches Gemisch aus Theater, Grand Hotel und Dom.
Mit den Baha’is hatte ich auch in späteren Jahren immer wieder Kontakt. So wurde ich, einige Jahre nach meiner Ernennung nach Bern, von den Frankfurter Baha’is angefragt, ob ich bereit sei, in einer von ihnen geplanten Weltfriedens-Gebetsandacht mitzuwirken. Jeder Teilnehmer sollte einer anderen Religion angehören und aus deren heiligem Buch Sätze über den Frieden lesen. Von mir erbat man, die Rolle des Muslims zu übernehmen. Denn man könne keinen Muslim fragen, das sei mit zu viel Gefahr für den Befragten verbunden. Ob diese Begründung stimmte, weiß ich nicht. Tatsache ist aber, dass die Baha‘is damals (und z.T. noch heute) in mehr als einem muslimischen Land verfolgt wurden und werden. Ich sagte zu, zweifelte aber (ich muss es zu meiner Schande gestehe), ob ich im Koran solche Friedenssätze finden würde. Ich fand sie und begann dann im Tempel zu Hohenheim meinen Beitrag, einer plötzlichen Eingebung folgend, mit der Basmalah, so dass Anwesende, die mich nicht kannten, mich tatsächlich für einen Muslim halten mussten..
RÜHL
Rühl, der Frankfurter Türkischlektor, hatte als Berater in der osmanischen Armee gewirkt. Sein Kabinett, Türme von Büchern auf dem Boden und auf diversen Tischen und Tischchen, wirkte exotisch. Er hatte eine türkische Sprachlehre verfasst, die er im Unterricht benutzte, sprach aber während des Unterrichts nie einen Satz Türkisch. So kam es, dass mein Türkisch ziemlich rudimentär geblieben war. Plötzlich, unerwartet, erhielt ich ein Stipendium für Ankara.
ANKARA
Die Grundlage war ein Austausch zwischen den juristischen Fakultäten von Frankfurt und Ankara. Türken gab es genug, die nach Deutschland wollten, aber in der juristischen Fakultät der Goethe-Universität wollte niemand nach Ankara. Daher klopfte man beim orientalischen Seminar an. Das Seminar umfasste damals nur einen einzigen Raum, von dem am Rand eine winzige Zelle mit schmalem, offenen Zugang für Ritters Schreibtisch abgetrennt war. Ritter rief mich zu sich: „Wollen Sie ein Jahr lang in Ankara studieren?“ Ich fiel aus allen Wolken, nahm aber ohne Zögern an. Freilich, was ich nicht wusste: Die Stipendiumssumme wurde in Ankara 1 zu 1 berechnet und die türkische Lira war damals nur etwa ein Drittel einer DM wert, das reichte also nicht. Zum Glück fand sich aber in Ankara ein Ausweg aus der Klemme: Ich durfte Deutschunterricht für Erwachsene an der Deutschen Bibliothek erteilen und verdiente damit genügend, um mich über Wasser zu halten.
Mit dem Orientexpress ab Frankfurt, Umsteigen in Belgrad, kommunistische Tristesse, im Zug nun türkische Familien, die dort ihre mitgebrachten Lebensmittel auspackten, mir anboten mitzuessen. Ankunft in Istanbul, Lastträger (hammâl) umdrängten die Ankommenden. Einer riss mir den Koffer aus der Hand, im Bahnhof Sirkeci gab es damals keine Gepäckaufbewahrung, nur mit Holztüren verschlossene Gewölbe in einer Mauer auf der anderen Seite der Straße. Dort wollte der hammal meinen Koffer verschließen. Ich dachte: „Den siehst du nie wieder!“ Gott sei Dank kam ein Taxi, ich winkte, er hielt, ich zeigte auf meinen Koffer, stieg ein und nannte die einzige Adresse, die ich für Istanbul hatte, die des Deutschen Klubs. Es war ein Restaurant. Der Inhaber wusch dem Taxifahrer den Kopf, als er hörte, welchen Preis der von mir verlangt hatte. Er empfahl mir ein Hotel.
In Ankara kannte ich niemand. Kulturattaché Rummel, von Haus aus Turkologe, kümmerte sich um mein Unterkommen im besten Studentenwohnheim von Ankara, dem Koc Talebe Yurdu in der Maltepe-Straße, wo ich mit drei Türken in einem Zimmer wohnte, ins Wasser geworfen, schwimmen müssen, für mein rudimentäres Türkisch natürlich die beste Methode. Ich verwendete denn auch einen großen Teil meiner Zeit auf die Förderung meiner Türkischkenntnisse Die Grammatik hatte ich ja theoretisch im Kopf, was mir aber völlig fehlte, war die Praxis, und dafür hatte ich ja nun ausgiebig Gelegenheit. Etwa nach einem halben Jahr sprach und verstand ich leidlich, am Ende des Jahres recht ordentlich, fließend. Um türkischen Vorlesungen folgen zu können, hätte ich allerdings noch ein weiteres Jahr bleiben müssen.
DIE TÜRKISCHE SPRACHE
Das Türkische war im Übrigen damals noch völlig im Umbruch. Unter Atatürk hatte ja eine staatlich geförderte Sprachreinigung begonnen, deren Ziel es war, das bis zu 90 Prozent von arabischen und persischen Vokabeln durchsetzte Osmanisch der Gebildeten in eine türkische Sprache zu verwandeln. Man griff dabei auf ältere vorosmanische Sprachdokumente, Volksliteratur, und in der Umgangssprache der einfachen Leute erhaltene Vokabeln zurück, schuf nach bestimmten Paradigmen hunderte oder gar tausende von Neologismen. Zahlreiche Schriftsteller, Journalisten, Intellektuelle beteiligten sich an deren Benutzung und Verbreitung. Die Begeisterung war so groß, dass das Neutürkische bald allzu üppig ins Kraut schoss. Ich selber machte mir den Spaß, einmal mit einem neutürkischen Lexikon im Studentenheim von Zimmer zu Zimmer zu gehen, eine beliebige Seite aufzuschlagen und die Bewohner zu fragen, ob sie diese Wörter kennten. Die Antwort war meist negativ.
Das war 1957. Aber die Türkisierung des Türkischen schritt doch voran – Anweisungen der Sprachakademie halfen die gröbsten Auswüchse vermeiden – und trug zu einer neuen Selbstfindung der Türken bei. Einen gravierenden, aber unvermeidlichen Nachteil hatte diese Entwicklung freilich: Sie führte zu einem Bruch zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Junge Leute meiner Generation, die noch in arabischer Schrift geschriebene Post von ihren Eltern bekamen, konnten sie nicht lesen (Atatürk hatte ja die arabische Schreibung des Türkischen 1924 verboten). Und die Inschriften auf Grabsteinen oder an Moscheen blieben ihnen ebenfalls verschlossen. Doch das war zu verschmerzen. Wir Deutschen können ältere Inschriften auf Gedenksteinen ja in der Regel auch nicht mehr, oder nur noch mit Mühe, entziffern. Der Aufbruch in der (neu)türkischen Literatur war rasant. 1954 erschien der erste große Roman „Memed mein Falke“ (Ince Memet) von Yasar Kemal.

Das Buch zählt unverändert zu den Meisterwerken der neutürkischen Literatur. Faszinierendes gab es auch in der modernen türkischen Lyrik, die sich aus den seit Jahrhunderten gültigen Fesseln der Ghaselendichtung gelöst und Verse in freien Rhythmen oder Strophen nach europäischem Vorbild zu schaffen begann, ein Vorgang, der sich analog ja auch in der arabischen, persischen und hindustanischen Literatur vollzog.
ANNEMARIE SCHIMMEL
Annemarie Schimmel war damals Dozentin an der Ilahiyat Fakültesi (Theologischen Fakultät) und hielt türkische Vorlesungen über Religionsgeschichte (dinler Tarihi), aus denen eines ihrer türkischen Bücher hervorging, und über islamische Kunst, für die sie mir und der kleinen Schar der türkischen Hörerinnen und Hörer die Augen öffnete, zumal sie immer Objekte und Photos mitbrachte, die sie herumgehen ließ. Sie bot mir schon nach kurzer Zeit das Du an, lud mich in ihre Wohnung, wo noch die „Tante Mama“, ihre erstaunliche Mutter, waltete.
Wenn wir zusammen das Fakultätsgebäude verließen, schossen oft aus den grünen Hecken, die den Bürgersteig säumten ein oder zwei riesige weißgraue Angora-Katzen hervor und auf Frau Schimmel zu. Und obwohl sie nicht gerade sauber waren, beugte sich diese, hob sie hoch und drückte sie an ihre Brust. Katzen waren ja ihre große Liebe, aus der viele Jahre später ihr schönes Büchlein „Die orientalische Katze“ hervorgehen sollte (Diederichs 1983).
Zu meinen schönsten Erinnerungen gehört eine mit ihr unternommene Reise nach Konya, wo uns der Kurator des Mevlâna-Museums, der liebenswürdige Mehmet Önder, wie alte Freunde empfing. Es war die erste in einer langen Reihe gemeinsamer wissenschaftlicher Reisen, nach Teheran, nach Kabul, nach Lahore, aber auch in europäische und amerikanische Städte, manchmal auch nur des Zusammentreffens am Zielort, Perspektiven, von denen ich damals freilich noch nichts ahnte.